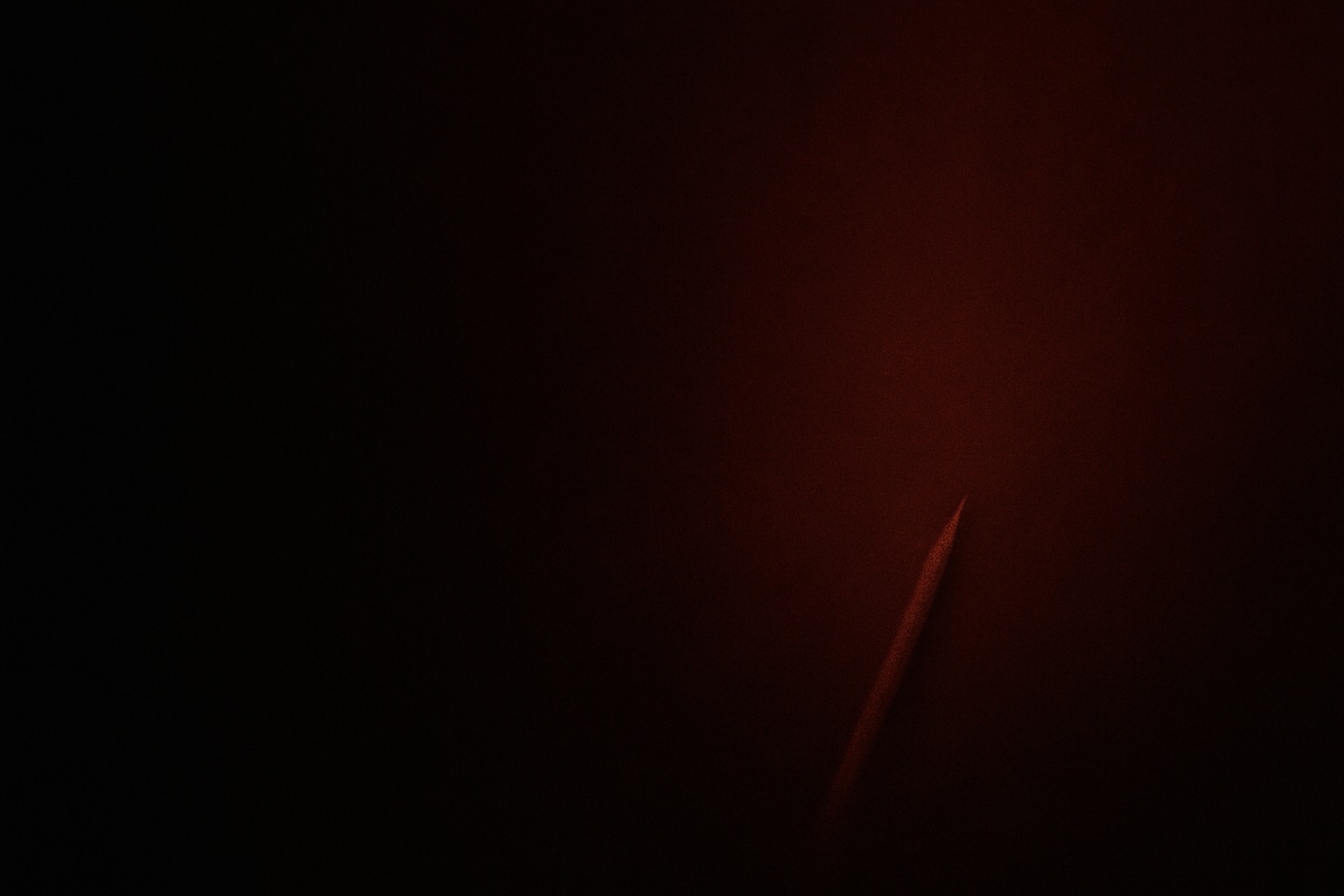Am Morgen, wenn noch alles ruhig ist und ich die verbleibende Müdigkeit der Nacht langsam abschüttele, setzt manchmal etwas in mir ein. Ich sitze vor einem Manuskript, bereit, mit dem Schreiben zu beginnen – und spüre, wie sich etwas anspannt, bevor überhaupt ein Wort auf dem Bildschirm verewigt ist.
Es beginnt leise. Ein enges Gefühl in der Brust. Ein Gedanke, der zu laut ist, obwohl er kaum ein Flüstern wäre, wäre er jemand anderes. Manchmal fühlt es sich an, als würde der Raum kleiner werden, obwohl mir selbstredend bewusst ist, dass er unverändert um mich steht.
Angst kann ein großer, gar gewaltiger Sturm sein; das ist mir – leider – nur allzu bekannt. Sie bricht wie etwas Körperloses über mich herein, entzieht mir die Luft zum Atmen, stellt die gesamte Welt auf Alarm. Dann ist keine Rationalität mehr übrig. Nur noch ein inneres Zittern, eine kaum auszuhaltende Verzweiflung, die alles übertönt.
Doch meistens ist Angst subtiler. Sie setzt sich neben mich, als würde sie dazugehören, als wäre sie eingeladen. Und dann beginnt sie mit dem, was sie am besten kann.
Sie erzählt mir Geschichten aus der Vergangenheit, die ich längst hätte vergessen wollen. Erinnerungen, die ich nicht eingeladen habe, aber die sie mit einer Selbstverständlichkeit ausbreitet, als wären sie ein Teil des Morgens. Sie konstruiert Sorgen und schürt Fantasien, für die es keine reale Grundlage gibt.
Und plötzlich höre ich sie sagen: „Lass es. Du bist nicht genug. Das muss dir doch bewusst sein.“
Angst hat ein gutes Gedächtnis. Sie weiß genau, wo sie anzusetzen hat. Sie macht mich klein, unbedeutend, überflüssig – und manchmal sogar schuldig, ohne dafür einen wirklichen Grund zu haben.
Und trotzdem hat Angst etwas an sich, das ich erst spät verinnerlicht habe: Sie versteht das Schreiben.
Sie weiß, dass Schreiben bedeutet, sich selbst auszuhalten. Dass jeder Satz aus etwas entsteht, das ich nicht vollständig begreife. Dass ich mich Figuren nähere, die das aussprechen, was ich im Alltag vermeide.
Dass sie alle ein Teil von mir sind.
Die Angst weiß, dass ich in meinen Texten nicht das Licht suche, sondern die Schatten. Und wenn ich ganz ehrlich bin: Manchmal hilft sie mir dabei.
Nicht, indem sie mich lähmt – sondern indem sie mich zwingt, genauer hinzusehen. Angst ist ein Spiegel. Sie zeigt mir, wo ich verletzlich bin, wo ich fliehe, wo ich mich selbst sabotiere. Und genau diese Stellen sind oft die, aus denen später meine dunkelsten, ehrlichsten Ideen entstehen.
Angst kann brutal sein. Es gibt Tage, an denen ich gar nichts schaffe. Nicht, weil ich keine Ideen hätte, sondern weil die Angst sich wie ein unermessliches Gewicht auf meine Hände legt. Dann schäme ich mich. Dann ärgere ich mich. Dann denke ich, ich sei zu schwach, um das zu tun, was ich eigentlich liebe.
Aber vielleicht gehört das dazu. Vielleicht ist Schreiben auch ein Rhythmus aus Atemholen und Aushalten. Aus Öffnen und Rückzug. Aus Mut und Angst.
Und manchmal – mehr als ich früher geglaubt hätte – setzt sich die Angst irgendwann zurück in ihre Ecke, lässt die Schultern sinken und beobachtet mich nur noch.
Dann schreibe ich. Nicht gegen sie, sondern trotz ihr. Manchmal sogar mit ihr.